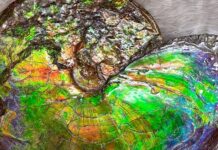Städte auf der ganzen Welt kämpfen mit einer wachsenden psychischen Krise. Während städtische Grünflächen als kostengünstige Lösung zur Verbesserung des Wohlbefindens vielversprechend sind, ist die Frage, wie viel Grün wirklich nützlich ist, unklar geblieben. Eine neue, in Nature Cities veröffentlichte Studie von Forschern der University of Hong Kong (HKU) liefert eine eindeutige Antwort: Mäßige Mengen an städtischem Grün sind der Schlüssel zur Maximierung psychologischer Vorteile und widerlegen die Annahme, dass „mehr Grün immer besser ist“.
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jeder achte Mensch weltweit mit einer psychischen Störung lebt, eine Behandlung für die meisten jedoch weiterhin unerreichbar ist. Städtische Begrünung hat als potenzielle Lösung an Bedeutung gewonnen, da sie nachweislich Stress, Angstzustände und Depressionen reduziert und gleichzeitig die kognitiven Funktionen verbessert. Frühere Studien lieferten jedoch inkonsistente Ergebnisse und konnten keine klaren Ziele für Stadtplaner festlegen. Diese neue Forschung schließt diese kritische Lücke, indem sie jahrzehntelange globale Daten analysiert, um die optimale „Dosis“ Grün für das geistige Wohlbefinden zu ermitteln.
Unter der Leitung von Professor Bin Jiang führte das Team eine strenge Analyse durch, die 69 quantitative Studien umfasste, die zwischen 1985 und 2025 veröffentlicht wurden. Sie untersuchten Daten von fünf Kontinenten, die über 500 Datensätze umfassten und verschiedene Arten von Grünflächen darstellten, sowohl von der Straßenebene als auch von oben betrachtet. Die Metaanalyse bestätigte einen konsistenten umgekehrten U-förmigen Zusammenhang: Der Nutzen für die psychische Gesundheit nimmt mit zunehmender Grünheit bis zu einem moderaten Schwellenwert zu, erreicht an diesem Punkt ein Plateau und nimmt dann ab, wobei er sich über diesen Punkt hinaus potenziell nachteilig auswirken kann.
Eine Balance finden: Die optimalen grünen Schwellenwerte
Die Ergebnisse zeigen spezifische Schwellenwerte sowohl für das Grün auf Augenhöhe (was Menschen beim Navigieren durch die Stadt erleben) als auch für das Grün von oben (annähernd durch Satellitenbilder). Bei Ansichten auf Straßenebene erreichen die Vorteile ihren Höhepunkt bei 53,1 % Grünabdeckung, mit einem äußerst vorteilhaften Bereich zwischen 46,2 % und 59,5 % und einem nicht nachteiligen Bereich zwischen 25,3 % und 80,2 %. Top-down-Perspektiven zeigen ein ähnliches Muster mit einem Höchstwert von 51,2 %, mit einem äußerst vorteilhaften Bereich zwischen 43,1 % und 59,2 % und einem nicht nachteiligen Bereich von 21,1 % bis 81,7 %. Diese Ergebnisse stimmen mit etablierten Theorien wie dem Yerkes-Dodson-Gesetz überein, das darauf hindeutet, dass optimale Leistung (in diesem Fall geistiges Wohlbefinden) bei mäßiger Stimulation auftritt.
Praktische Implikationen für Städte: Planung für das geistige Wohlbefinden
Diese Forschung bietet einen leistungsstarken Rahmen für Stadtplaner und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens. Anstatt der konsequenten Ökologisierung Priorität einzuräumen, können Städte nun auf diese spezifischen Schwellenwerte abzielen, um den Nutzen für die psychische Gesundheit zu maximieren und gleichzeitig die Ressourcenallokation zu optimieren. Als besonders wichtig erweist sich die Begrünung von Straßen und öffentlichen Plätzen auf Augenhöhe, die den Vorrang bei der Gestaltung rechtfertigt. Die festgelegten Schwellenwerte ermöglichen es Planern auch, Mindestwerte für die Grünflächendeckung festzulegen, um das psychische Wohlbefinden zu schützen und zu verhindern, dass die Erträge über einen bestimmten Punkt hinaus sinken. Dieser gezielte Ansatz unterstützt eine gerechtere Verteilung städtischer Flächen und Instandhaltungsressourcen.
„Diese Arbeit zeigt, wie Umweltinterventionen kritische Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit angehen können“, erklärt Professor Peng Gong, Vizepräsident und Pro-Vizekanzler (Akademische Entwicklung) an der HKU und Mitglied des Forschungsteams. „Es liefert dringend benötigte Beweise, um nachhaltige Entwicklungsziele in Bezug auf Gesundheit, Wohlbefinden und nachhaltige Städte zu erreichen.“
Professor Jiang betont, dass der bedeutendste Beitrag darin liegt, den allgemeinen krummlinigen Zusammenhang zwischen Grünheit und psychischen Gesundheitsergebnissen zu etablieren. Er unterstreicht außerdem zwei wichtige Erkenntnisse: erstens die Entlarvung des Mythos, dass „mehr Grün immer besser ist“, und das Hervorheben der potenziellen Nachteile einer übermäßigen Begrünung; Zweitens muss gezeigt werden, wie moderate Grünflächen ausreichen, um optimale Vorteile zu bieten und gleichzeitig eine Überallokation von Ressourcen zu verhindern. Dieses empfindliche Gleichgewicht ist besonders wichtig für dicht besiedelte Städte wie Hongkong, wo die Maximierung der Grünflächen oft mit anderen dringenden städtischen Bedürfnissen kollidiert.
Professor Chris Webster, Lehrstuhlinhaber für Stadtplanung und Entwicklungsökonomie an der HKU, fasst die doppelte Wirkung der Studie zusammen: „Wir haben belastbare Beweise für eine krummlinige Beziehung geliefert, die jahrzehntelange fragmentierte Erkenntnisse beendet. Zweitens haben wir dieses Muster in praktische Schwellenwerte übersetzt, die direkt in Begrünungsrichtlinien und Landschaftsgestaltungsstandards einfließen.“
Indem diese Forschung eine klare Richtung für die Erzielung optimaler psychischer Gesundheitsvorteile durch Stadtbegrünung vorgibt, versetzt sie Städte in die Lage, fundiertere Entscheidungen über die Ressourcenzuteilung zu treffen und das Wohlergehen ihrer Bürger in den Vordergrund zu stellen.